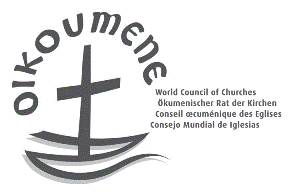Der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, Günter Nooke, hat die Debatte über den Mord an zwei deutschen Entwicklungshelferinnen im Jemen kritisiert. Die Diskussion drohe in die falsche Richtung zu gehen, sagte Nooke der Zeitung "Rheinpfalz am Sonntag". Es sei absurd, den beiden jungen Frauen vorzuwerfen, sie hätten durch eine "missionarische" Tätigkeit selbst Schuld an ihrem Tod. Wenn man das akzeptiere, dann hätten auch die Toten an der Berliner "Mauer" selbst Schuld getragen, weil sie sich in Gefahr begeben hätten.
Zum Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit gehöre, seine Religion offen vertreten zu dürfen, so der CDU-Politiker: "Dazu zählt in gewisser Weise auch der Missionsauftrag". Mission sei nicht verboten, betonte Nooke. Religion sei keine Privatsache. Es könne nicht sein, dass die Abkehr vom Islam mit dem Tode bedroht werde, während die Christen mit der Schere im Kopf "leben müssen und nicht einmal mehr über ihre Religion reden dürfen".
Nach der Ermordung der beiden jungen Frauen läuft in Deutschland eine Debatte darüber, ob Engagement in einem Land wie dem Jemen zu verantworten sei. Die beiden jungen Frauen waren Studentinnen einer evangelikalen Bibelschule im westfälischen Lemgo; im Jemen waren sie mit einer niederländischen Hilfsorganisation im Einsatz.
Nooke meinte, in Deutschland würden Moscheen auch dort gebaut, wo keine Muslime wohnen. Überzeugte Christen hätten das Recht, ihre Religion öffentlich zu vertreten, auch wenn das in vielen islamisch dominierten Ländern und speziell im Jemen lebensgefährlich sei. In welche Situation sich jemand freiwillig begebe, "muss jeder selbst entscheiden und liegt in der Verantwortung der entsendenden Organisationen". Doch auch in solchen Ländern müsse ein offenes Vertreten des christlichen Bekenntnisses möglich sein. Das setze nicht die ins Unrecht, "die missioniert haben, sondern jene, die die beiden jungen Frauen kaltherzig ermordeten und die Staaten, die dagegen nur halbherzig vorgehen".
Die missionarische Tätigkeit steht unter dem Schutz des Rechtes auf Religionsfreiheit. Das ergibt sich zunächst aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, in rechtsverbindlicher Form sodann aus dem Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte von 1966. In Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung heisst es: "Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Das Recht umfasst die Freiheit, seine Religion ... zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion ... öffentlich oder privat ... zu bekunden." Wer Christen - wo auch immer - empfehlen würde, möglichst unauffällig ihre Gottesdienste abzuhalten und nicht durch missionarische Aktivitäten zu "provozieren", würde nicht nur die missionarische Dimension des christlichen Glaubens, sondern auch einen wesentlichen Kern des Rechts auf Religionsfreiheit verfehlen.